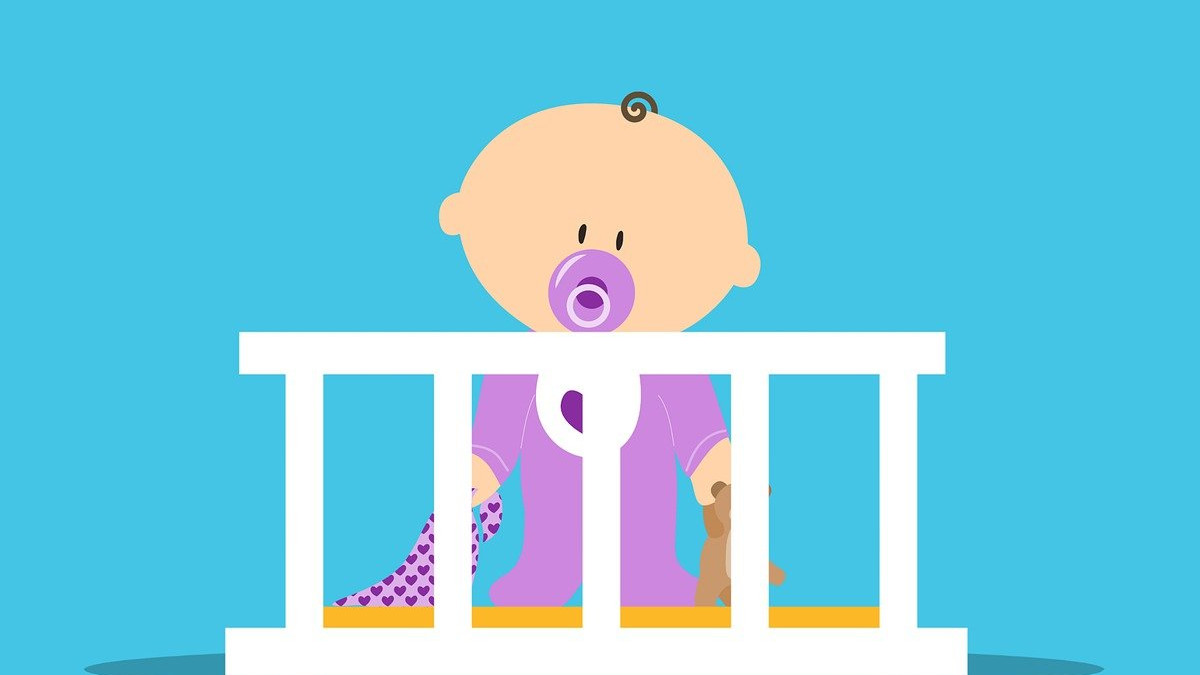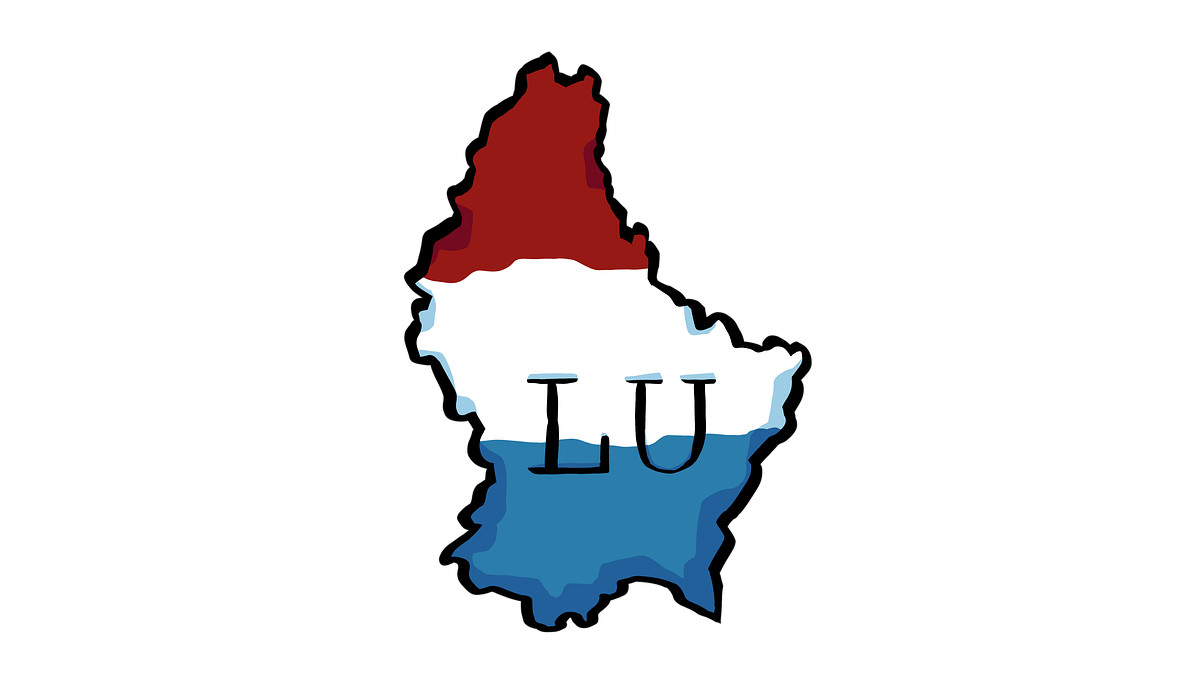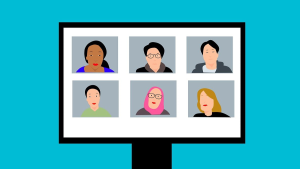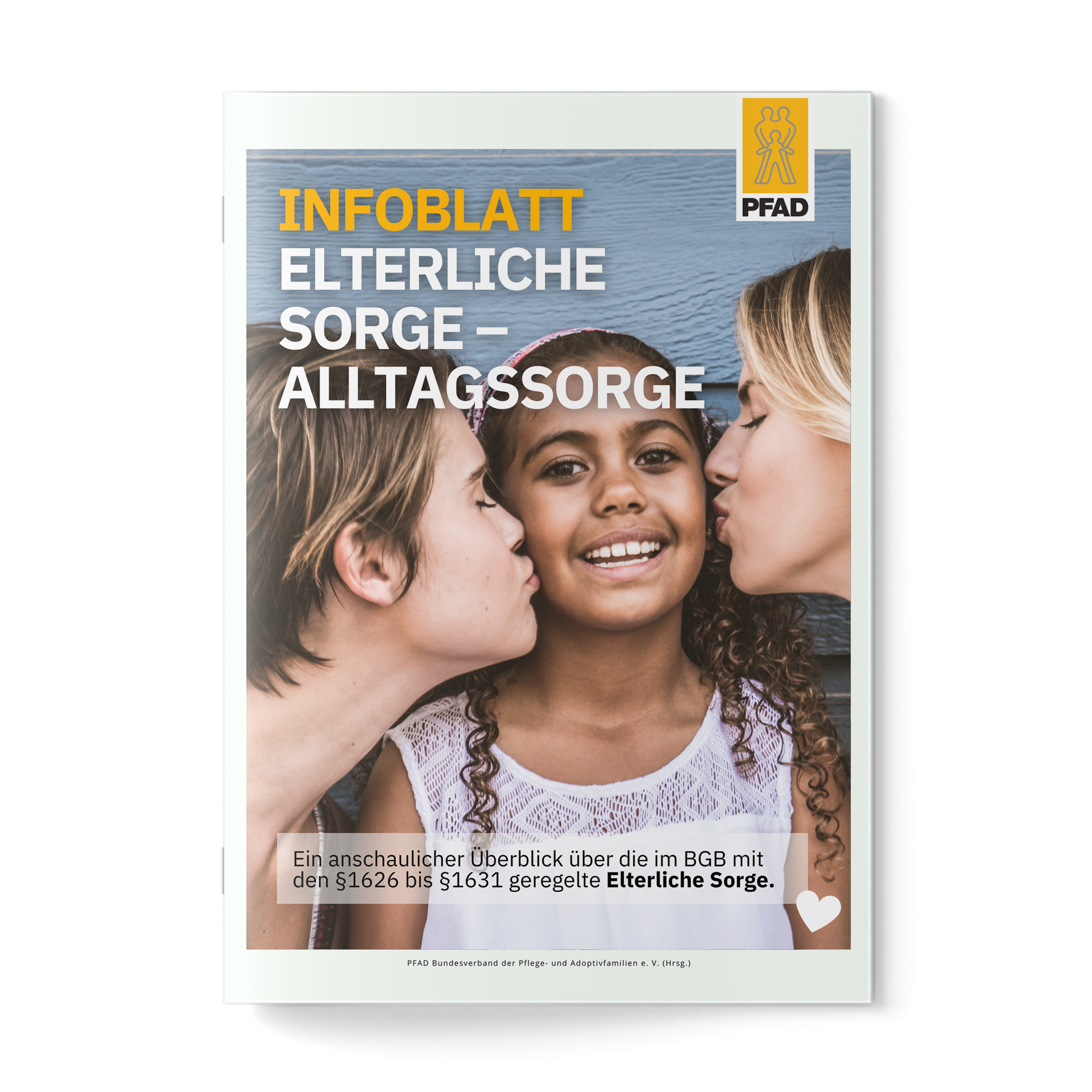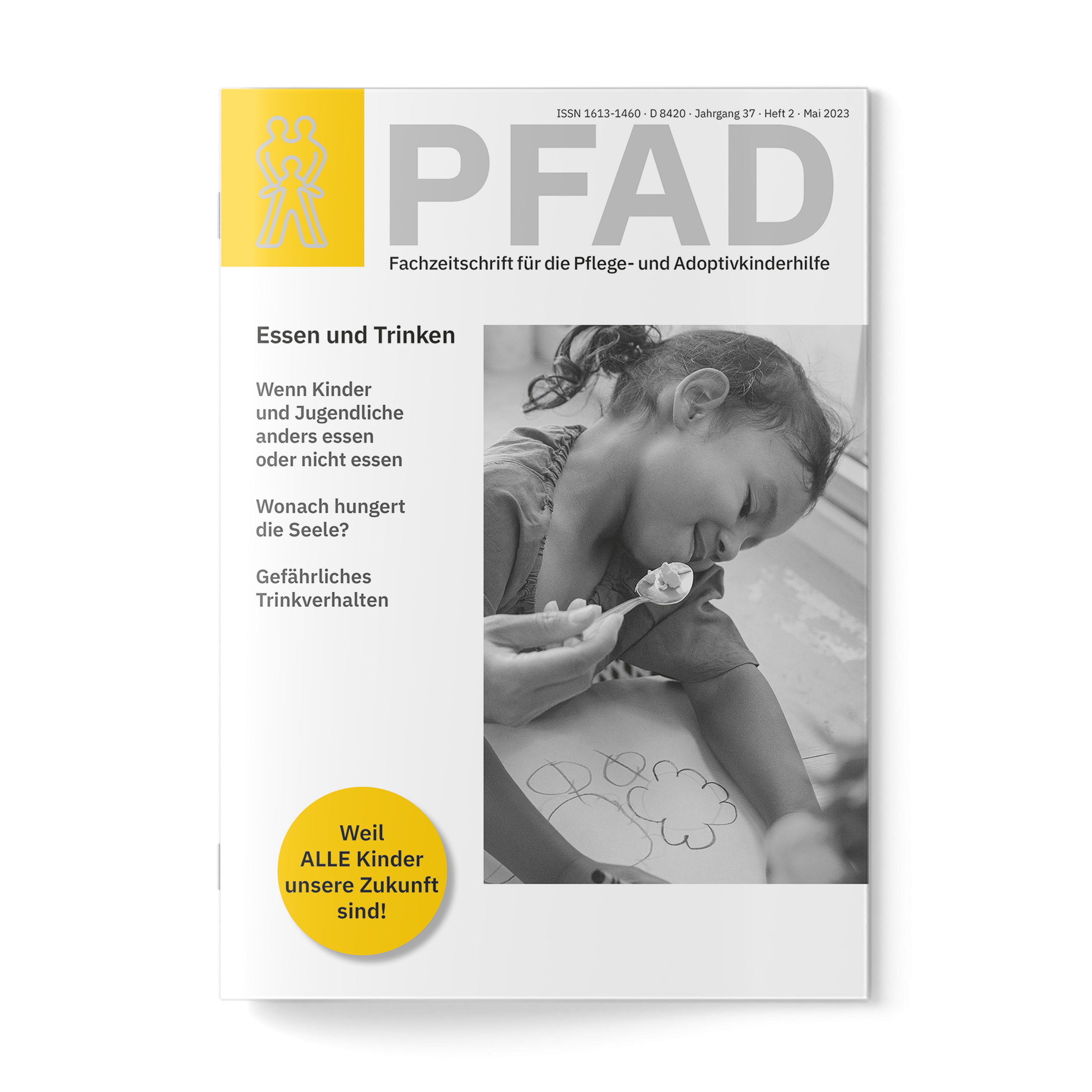Der PFAD Bundesverband ist ...
…Interessenvertretung der Pflege- und Adoptivfamilien
…Dachverband für Landesverbände und Ortsgruppen
…Fachverband für Vollzeitpflege und Adoption
…Träger der freien Jugendhilfe
…Selbsthilfeverband
…gemeinnützig
PFAD ist eine Abkürzung und steht für PFlege und ADoption.

Der Bundesverband

Adoption
Durch die Adoption erhält ein Kind neue rechtliche Eltern. Adoptivfamilien können bei Bedarf auf Beratungs- und Vernetzungsangebote zurückgreifen.

Vollzeitpflege
Pflegekinder wachsen mit zwei Familien auf: ihren leiblichen Eltern und den Pflegeeltern. Fachkräfte des Jugendamtes begleiten ihre Entwicklung.
PFAD Neujahrsempfang 2024
Am 31. Januar luden wir wieder Kooperationspartner*innen und Akteure aus der fachpolitischen und politischen Ebene nach Berlin ein, um unsere aktuellen Positionen und Forderungen vorzustellen und zu diskutieren.

Bereitschaftspflege
Hohe Ansprüche, aber schlechte Absicherung für Pflegepersonen
Aktuelles rund um Adoptiv- und Pflegekinder
Weitere Meldungen unter AKTUELLES
News aus dem PFAD Verband
207.000
Kinder und Jugendliche
konnten im Jahr 2022 in Deutschland nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen.
Pflegefamilien boten im Jahr 2022 rund 86.000 von ihnen ein sicheres und behütetes Zuhause. Leider sind die Bewerberzahlen rückläufig. Deshalb werden in ganz Deutschland Familien gesucht, die im Herzen und Zuhause noch Platz haben. Damit vor allem kleine Kinder nicht in Heimeinrichtungen untergebracht werden müssen.
Sie sind interessiert an Informationen?
Sie haben Fragen oder suchen Beratung?
Das PFAD Beratungstelefon und unsere Informations- und Geschäftsstelle in Berlin unterstützen Sie gerne. Auch für weitere Anliegen stehen Ihnen unsere Vorstände und Mitarbeiter*innen zur Verfügung.
Sie wollen sich weiterbilden?
Mit den vielfältigen Themen unserer Online-Seminare erreichen wir viele Adoptiv- und Pflegeeltern sowie Fachkräfte der Jugendhilfe. Die Teilnahme ist einfach und für PFAD Mitglieder kostenfrei.
Neuer jährlicher Aktionstag würdigt gesellschaftliches Engagement von Adoptiv- und Pflegefamilien.
Initiiert wurde die Aktion vom PFAD Bundesverband in Kooperation mit dem Forschungskonsortium EMPOWERYOU. Die Auftaktveranstaltung 2023 wurde finanziell gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Weiterlesen
Der Aktionstag 2024 wird am 08. Juni in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Weitere Informationen folgen demnächst…
PFAD in Zahlen
Forschungsprojekte und Umfragen – Machen Sie mit!

Nutzen Sie die kostenfreien EMPOWERYOU Online-Programme
Mit zwei Online-Programmen werden Pflege- und Adoptiveltern sowie junge Menschen selbst gestärkt.
Hier erfahren Sie, wie man jetzt noch teilnehmen kann.
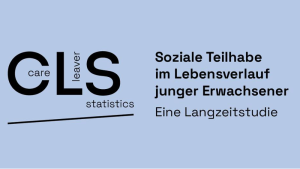
CLS-Studie
Die Forscher*innen der CLS-Studie suchen junge Menschen zwischen 16 und 19 Jahren, die noch in ihren Pflegefamilien leben, für Befragungen. Die erste bundesweite Langzeitstudie zu Lebensverläufen von Careleavern soll wichtige Informationen für eine Verbesserung der Ausgestaltung von Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie Jugendhilfe geben.
Stellen Sie Ihre Erfahrung der Forschung zur Verfügung!
Unterstützen Sie bitte die wichtige Forschung im Bereich Adoption und Vollzeitpflege durch Ihre Teilnahme an Studien. Hier finden Sie Forschungsprojekte, für die aktuell noch Probanten gesucht werden.